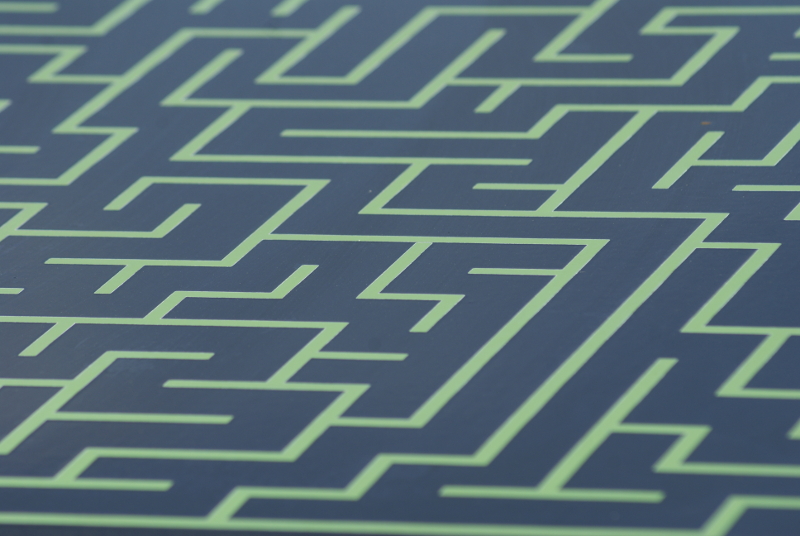Die Stories halten sich hartnäckig. Derivate stürzen Unternehmen, Banken und Kommunen in den Ruin. Land Salzburg, Stadt Pforzheim, IKB oder Lehman, ihnen allen sollen Derivate das Genick gebrochen haben. Das klingt in den Medien gut und lässt sich gut gegenüber all jenen verkaufen, die wenig bis keine Ahnung haben, was Finanzderivate überhaupt sind und wie sie funktionieren. Tatsächlich aber ist es in den meisten Fällen so, dass nicht die Derivate Schuld an Ruin und Untergang tragen. Die Probleme beginnen in der Regel lange zuvor auf der Asset- oder Liabilityseite.
Derivate als Absicherungsinstrumente
Unternehmen, Banken und Kommunen, die ein seriöses Finanzmanagement betreiben – und das sollten hoffentlich beinahe alle mit wenigen Ausnahmen sein – verwenden Derivate in erster Linie und meist sogar ausschließlich zu Absicherungszwecken. So ist es für Banken, die sich variabel über den Geldmarkt finanzieren, wichtig, ihre vergebenen Kredite und begebenen Anleihen und Schuldscheindarlehen von fix auf variabel zu swappen. Zinsrisikomanagement bei Unternehmen läuft häufig genau spiegelverkehrt. Zinsderivate dienen der Liquiditätssteuerung, der Durationssteuerung und dem Cashflow Management. Unternehmen setzen Derivate ein, um Rohstoffpreise oder Wechselkurse abzusichern, und eine Vielzahl an Marktteilnehmern verwendet Kreditderivate, um das Ausfallrisiko von Gegenparteien zu managen. Das hat nichts mit Spekulation zu tun, sondern mit Risikomanagement. Dass Unternehmen Derivate in der Regel zur Absicherung einsetzen und sehr selten spekulieren, wurde schon mehrfach untersucht. Eine gute Publikation findet sich im Journal of Corporate Finance, Vol. 57, von August 2019 mit dem Titel „Corporate Hedging and Speculation with Derivatives“ von Bartram Söhnke. Die Studie zeigt auf, dass Unternehmen mit Derivaten ihre finanziellen Risiken reduzieren und nicht erhöhen.
Probleme schlummern bei Assets, Krediten, Bonds und CPs
Die grundlegenden Probleme für den Untergang großer Banken und Unternehmen liegen in der Regel anderswo. Lehman musste tatsächlich deshalb Chapter 11 anmelden, weil es seinen Collateralverpflichtungen für Derivatepositionen nicht mehr nachkommen konnte. Das lag aber weniger an den Derivaten selbst, sondern am kollabierenden Geschäftsmodell von Lehman. Die Investmentbank hatte sich unter anderem – ähnlich wie Bear Stearns auch – auf die Finanzierung von Hedgefonds spezialisiert. Für günstige Finanzierungen an die Fonds durfte Lehman im Gegenzug deren Asset Portfolio ausleihen. Davon machte Lehman regen Gebrauch und wandelte diese ausgeliehenen Assets auf dem Repomarkt in Liquidität um. Der eigene Assetpool, der als Liquiditätsreserve deklariert war, bestand hingegen aus großteils illiquiden Verbriefungstranchen. Das ging lange Zeit gut und verhalf Lehman zu Milliardengewinnen. Doch 2007 wurde der Markt nervös, Hedgefonds zogen ihre Mandate und damit ihre Assets ab, und das Kartenhaus brach in sich zusammen. An den Derivaten lag es nicht. Der Grund lag auf der Assetseite. Anderen Banken hingegen wurden ihre faulen Kredite zum Verhängnis, und Kommunen ihre zuvor viel zu hohe Verschuldung samt überaus belastender Zinslast, aus der Derivate einen Ausweg versprachen. Auch das ging über Jahre gut, doch irgendwann krachte auch dieses Kartenhaus in sich zusammen. Wieder war der Wurm im Grundgeschäft zu finden.
Derivate können missbraucht werden
Steht jemand bereits mit dem Rücken zur Wand und weiß keinen Ausweg mehr, können Derivate durchaus reizvoll sein. Denn sie sind in mehrerlei Hinsicht geeignet, um die wahre Lage zu verstecken, zu verschleiern oder die Katastrophe etwas nach hinten zu verschieben. Zunächst einmal sind Derivate Hebelprodukte, das heißt mit wenig oder gar keinem Einsatz können große Risikopositionen aufgesetzt werden, die allerdings erst in der Zukunft zahlungsmäßig wirksam werden. Die meisten Derivate stehen zudem nicht auf der Bilanz und lassen sich gut verstecken. Viele Leute verstehen nichts von Derivaten und überlassen diese Positionen lieber den „Experten“. Nicht zu vergessen, mit Derivaten lassen sich Zahlungsströme und Durationen steuern und dadurch auch manipulieren. Wenn Sie mithilfe eines Zinsswaps den Zahlungsstrom von 10 Jahren auf 50 Jahre strecken, dann wirken die einzelnen, jährlichen Zahlungen plötzlich gar nicht mehr so hoch. Am negativen Barwert hat sich hingegen nichts geändert, und das Risiko ist zusätzlich in die Höhe geschnellt, aber rein oberflächlich betrachtet wirkt alles wieder in Ordnung. Derivate können aufgrund ihrer Eigenschaften durchaus auch missbraucht werden. Beispiele sind etwa die Republik Griechenland oder die italienische Monte dei Pasci, und bestimmt noch so einige mehr, die nicht breit in den Medien bekannt wurden. Der Grund, warum in diesen Fällen Derivate überhaupt in dieser missbräuchlichen Form zum Einsatz kommen, liegt allerdings wieder auf der Asset- oder Liabilityseite im Grundgeschäft.
Derivate sehen auf den ersten Blick riesig aus
Vor allem bei Zinsderivaten ist es wenig hilfreich, dass immer noch standardmäßig in Statistiken, Reports und Risikosystemen als Maßeinheit der Nominalbetrag angegeben wird. Dieser hat bekanntlich – wir haben darüber schon ausführlich geschrieben – absolut keine Aussagekraft bezüglich Risiko, Laufzeit, Barwert und dergleichen. In Zeiten von standardmäßigem Netting, Central Clearing, Margining und Collateral Management haben addierte Nominalbeträge aller vorhandenen Zinsderivate noch viel weniger Aussagekraft. Sie wirken allerdings gigantisch und schüchtern ein. Selbst eine mittelgroße Bank kann zum kurzfristigen Zinsmanagement durchaus €STR Swaps mit Milliardennominal handeln, und das regelmäßig. Meist allerdings nur mit Laufzeiten von einigen Tagen. Rechnet man alle Nominalbeträge stur zusammen, ergeben sich schwindelerregende Zahlen, die jede Bilanzsumme um ein Vielfaches übersteigen. Dabei wäre es viel wichtiger, das DV01 zu kennen, also jenen Betrag, um den sich die Positionen verändern, wenn die Zinskurve um 0,01% verschoben wird. Oder auch den Barwert von Positionen. Aber niemals den Nominalbetrag.
Negative und positive Swapbarwerte sagen ebenfalls wenig aus
Dabei sagen Barwerte auch ziemlich wenig aus über die Gesamtsituation. Schließlich sind beinahe alle Derivate, die gehandelt werden, eine Absicherung für irgendein Grundgeschäft. Daraus folgt, dass ein positiver Barwert des Grundgeschäfts einen negativen Barwert in der Absicherung zur Folge hat, und umgekehrt. Größere Banken und Unternehmen sichern ihre Geschäfte zwar nicht mehr 1:1 ab, sondern verwenden Makropositionen zur Absicherung, aber das ändert nichts daran, dass sich Grundgeschäft und Absicherung im Wert normalerweise gegengleich entwickeln. Hier nur auf die Seite der Derivate zu achten wäre unsinnig. Man müsste die Geschäfte als Einheit sehen, um eine Aussage treffen zu können.
Derivate werden auch gerne vorgeschoben
Positionen in Derivaten können auch bei Unternehmen und Banken zu Verlusten führen. Die Derivate werden dann gerne vorgeschoben und es werden Aussagen gemacht, die in etwa so klingen: „Aufgrund von älteren Zinsderivate Positionen sind in den kommenden Jahren Belastungen des Ergebnisses zu erwarten.“ Doch auch hier liegt es selten direkt an den Derivaten, sondern die Verluste stammen aus dem Grundgeschäft, für das die Derivate einst abgeschlossen wurden. Manchmal wird beim Abschluss von Absicherungen auch geschlampt, was übrigens gar nicht so selten passiert. Es werden etwa Grundgeschäfte gekündigt oder verkauft, obwohl es dagegen noch einen Swap gibt, der weiterläuft. Es werden im Grundgeschäft Euribor Floors von 0% unterschrieben, im Swap dagegen nicht. Der Ursprung des Problems liegt zumindest bei allen Absicherungsderivaten wieder im Grundgeschäft. Da reine Zockerpositionen bei Derivaten heute eher die Ausnahme sind, sollten Analysten zunächst also die Asset- und Liabilityseite unter die Lupe nehmen und dort nachhaken. Denn Derivate sind selten die Ursache des Problems.